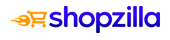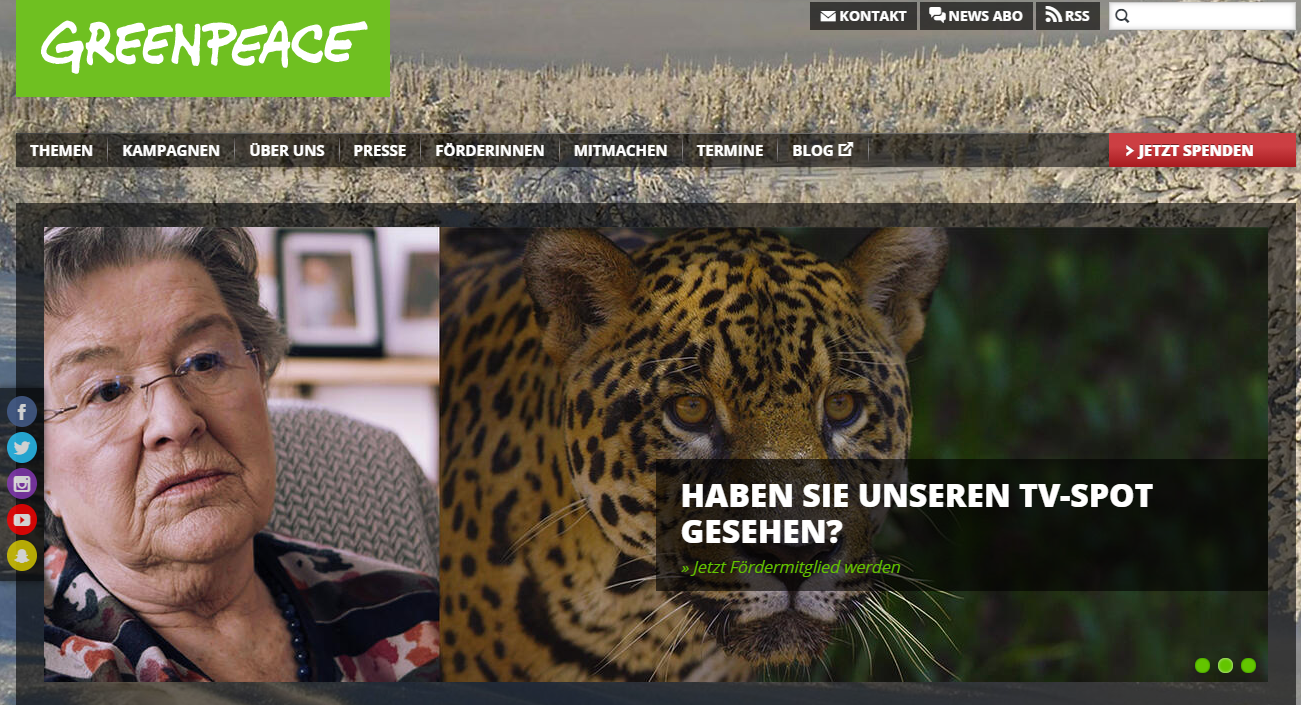>> Unsere Grenze ist Ihre Fantasie! <<
Bitte klicken Sie mit Ihrer Maus auf das jeweilige Bild Ihrer gesuchten Kategorie
Sie suchen ein Möbelstück, das zu Ihnen und Ihrer bereits vorhandenen Einrichtung perfekt passt? Oder Sie haben genaue Vorstellungen, was für Kriterien es erfüllen soll – können es aber nirgends bekommen?
biologisch – individuell – langlebig – einzigartig – schadstoffgeprüft
Ihr Spezialist für Möbelstücke nach Maß!
Rufen Sie uns an! (Täglich zwischen 9:00 und 22:00 Uhr) Wir beraten Sie gern und planen Ihr Lieblingsmöbel gemeinsam mit Ihnen natürlich unverbindlich und kostenlos – auf unsere langjährige Erfahrung im Möbelbau und unser sicheres Stilgefühl können Sie sich verlassen. Denn wir sind erst zufrieden - wenn Sie es auch sind!
Weil wir lieben, was wir tun, entstehen bei uns traumhafte und langlebige Möbel ganz nach Ihren Vorstellungen. Holen Sie sich Anregungen ( zb. unter Gesaltungsbeispiele ) oder rufen Sie uns einfach an - wir helfen Ihnen gern beim Entwerfen Ihres einzigartigen Lieblingsmöbelstück.
Social Media

Alle unsere Möbelstücke sind Einzelanfertigungen und werden noch nach alter Handwerker Tradition
zusammengebaut. Das heißt das alle Schubladen grundsätzlich gezinkt werden oder auch das über
100 Jahre alte Prinzip der „Zahnleiste“ wird bei uns angewendet.



Mehr als nur hübsch anzusehen- Massivholzmöbel und ihre Vorteile. ( wissen.de )
Ein Massivholzmöbelstück steht für Langlebigkeit, Robustheit und für seinen ganz eigenen Scharm
/Charakter. Durch die einzigartige Struktur eines Baumes wird jedes Möbelstück zum Unikat, an den
man sehr lange Freude hat.
Massivholzmöbel können sie dank seiner Pflegeleichtigkeit und Unverwüstlichkeit ein Leben lang
begleiten. Selbst Schrammen und Flecke lassen sich leicht und unkompliziert ausbessern, bzw.
entfernen. Übrigens das nachdunkeln von Massivholzmöbeln ist eine organische und ganz natürliche
Reaktion, auf das ultraviolette Licht. Selbst Papier mit einen hohen Holzanteil vergilbt mit der Zeit. Holz
,,lebt" auch wenn es verarbeitet würde. Aber gerade das macht Massivholzmöbel nur noch schöner und
charakteristischere//interessanter. Massivholzmöbel stehen für gesunderes Wohnen, Ökologie und Nachhaltigkeit.
Unsere Firmenphilosophie ist es, Möbel zu fertigen, mit denen Sie sich wohl fühlen, und die auf Grund
ihrer Qualität und Verarbeitung mehrere Generationen überdauern. Der Kauf unserer Möbel ist eine
gelungene Investition in die Zukunft und den Schutz unserer Umwelt.
Unser Partnershop für Ersatzteile :

Hilfsprojekte die uns am Herzen liegen und wozu wir Sie herzlich mit einladen wollen, mitzumachen und zu helfen.
Lassen Sie und gemeinsam die Welt ein kleines bisschen gerechter und fröhliche machen.
DANKE ..
für jede noch so kleine Unterstützung. (Denn jeder beitrag steuert dazu bei aus kleinem was ganz großes zu machen)